Ich bekomme diese Frage inzwischen fast wöchentlich: „Muss ich im Studium wirklich lernen, mit KI umzugehen? Wollen Arbeitgeber das überhaupt – oder ist es vielleicht sogar klüger, sich davon zu distanzieren?“
Meine Antwort: Ja, du solltest KI-Kompetenz lernen – aber reflektiert. Nicht jede Nutzung ist sinnvoll, und nicht jede Abstinenz schützt deine Glaubwürdigkeit. Entscheidend ist, wie du KI in dein Lernen integrierst, wann du sie einsetzt – und ob du ihr Denken mit deinem Denken verbinden kannst.
Als ich den KI Kompass für Studierende gestartet habe, ging es mir darum, Orientierung zu geben: Wie kann man mit KI lernen, ohne sich selbst das Lernen abzugewöhnen?
Diese Frage ist heute zentraler denn je. Viele Studierende erleben zwei gegensätzliche Diskurse:
- Auf der einen Seite die Euphorie: „Alle nutzen KI – wer’s nicht tut, ist selbst schuld.“
- Auf der anderen Seite die Skepsis: „KI zerstört das Vertrauen in Abschlüsse und macht wissenschaftliches Arbeiten sinnlos.“
Beide Extreme greifen zu kurz. KI verändert Studium und Arbeit grundlegend, ja – aber sie ersetzt nicht den Prozess des Denkens, Fragens und Verstehens. Ich sehe in meiner Arbeit täglich, dass Studierende, die KI bewusst nutzen, nicht unbedingt weniger, sondern meist tiefer lernen.
KI-Kompetenz ist eine neue Form von Studierfähigkeit
Wenn ich Studierende berate, sehe ich, dass sie KI noch als Zusatztechnik betrachten – wie Excel oder Photoshop. Doch in Wahrheit ist KI längst ein methodisches Grundinstrument: Sie kann Denkprozesse anregen, Perspektiven öffnen und Routinen entlasten. Aber sie kann auch das Gegenteil tun: Reflexion hemmen, wenn sie unkritisch genutzt wird.
Darum: Ja, du solltest KI üben – aber als Erkenntniswerkzeug, nicht als Abkürzung.
Wir werden in einer neuen Seminarreihe an der LMU Basiskompetenzen vermitteln:
- Verstehen, was KI kann – und was nicht. Ich analysiere gemeinsam mit ihnen, wo generative Modelle heuristisch denken (statt zu wissen).
- Qualität prüfen lernen. Ergebnisse werden nie einfach übernommen, sondern systematisch auf Plausibilität und Quellenbasis geprüft.
- Transparenz trainieren. Jede Nutzung gehört dokumentiert – Tool, Datum, Zweck. Das ist kein bürokratischer Zwang, sondern Teil wissenschaftlicher Ehrlichkeit.
Diese Haltung unterscheidet den reflektierten Einsatz von KI vom bloßen „Prompten“.
Was Arbeitgeber:innen wirklich erwarten
Viele Studierende glauben, Arbeitgeber:innen würden KI misstrauen. Das Gegenteil ist der Fall – in den meisten Branchen gilt KI-Kompetenz inzwischen als Schlüsselqualifikation. Entscheidend ist nur, ob du sie reflektiert einsetzt.
Arbeitgeber:innen achten hier meist auf drei Dinge:
- Zielorientierung: Kann jemand KI nutzen, um Aufgaben schneller und präziser zu lösen – ohne Qualität zu verlieren?
- Datenkritik: Kann jemand unterscheiden, wann ein Ergebnis belastbar ist und wann nicht?
- Kommunikation: Kann jemand offenlegen, wann und wie KI eingesetzt wurde?
In Bewerbungsgesprächen taucht die Frage inzwischen regelmäßig auf:
„Wie nutzen Sie KI in Ihrer Arbeit oder im Studium?“
Das ist kein Test, sondern eine Einladung: Zeig, dass du verstehst, wie KI funktioniert, und dass du sie nicht als Denkprothese, sondern als Reflexionsverstärker nutzt.
Abschlüsse, Vertrauen und Transparenz
Ich höre oft: „Man kann Abschlüssen doch gar nicht mehr trauen, wenn alle KI nutzen.“
Diese Sorge ist nachvollziehbar, aber sie ist eine klassische Sorge und verwechselt Hilfsmittel mit Täuschung. Das Vertrauen in akademische Abschlüsse sinkt nicht, weil Studierende KI verwenden, sondern wenn sie verbergen, dass sie es tun.
Transparenz ist hier die eigentliche Kompetenz:
- Wer KI offenlegt, beweist wissenschaftliche Integrität.
- Wer KI reflektiert dokumentiert, zeigt Verständnis für Qualität und Verantwortung.
- Wer KI unkritisch kopiert, verliert nicht nur Glaubwürdigkeit, sondern auch das eigene Lernpotenzial.
Kurz gesagt: Das Vertrauen in deinen Abschluss hängt nicht davon ab, ob du KI nutzt – sondern davon, ob du dabei ehrlich, methodisch und selbständig bleibst.
Sollte man also „keine Erfahrung mit ChatGPT“ in den Lebenslauf schreiben?
Ganz klar: Nein.
Das wäre in etwa so, als würdest du bei Computerkenntnissen schreiben: „Keine Erfahrung mit Suchmaschinen und Textverarbeitung.“
So etwas signalisiert nicht Bescheidenheit, sondern im Gegenteil u.U. fehlende Anschlussfähigkeit.
Ich empfehle, KI-Kompetenzen aktiv, aber verantwortungsvoll zu formulieren. Zum Beispiel so:
„Reflektierter Einsatz generativer KI-Tools (z. B. ChatGPT, Claude, Gemini) für Recherche-, Strukturierungs- und Analyseaufgaben. Kenntnis aktueller KI-Ethik- und Qualitätsstandards.“
Das klingt weder übertrieben noch anbiedernd – sondern zeigt, dass du mitdenkend arbeitest.
KI-Kompetenz ≠ KI-Abhängigkeit
Der entscheidende Punkt ist nicht, ob du KI nutzt, sondern wie du die Kontrolle behältst.
„KI kann dir helfen zu denken – aber sie darf dir das Denken nicht abnehmen.“
Diese Haltung unterscheidet reflektierte Nutzer:innen von passiven Konsument:innen.
KI ist ein Spiegel deines Denkens: Wenn du präzise, neugierig und kritisch fragst, lernst du über dich selbst – nicht nur über Technik.
Forschungstagebuch (Auszug)
- Oktober 2025: In Beratungen an der LMU häufen sich Fragen zur Glaubwürdigkeit von Studienleistungen im KI-Zeitalter.
- Viele Studierende fühlen sich zwischen „Muss ich das können?“ und „Darf ich das überhaupt?“ hin- und hergerissen.
- Ich beobachte: Angst vor Entwertung entsteht vor allem dort, wo Transparenzkultur fehlt.
Leitfragen
- Wie kann ich KI-Kompetenzen erwerben, ohne mein eigenes Denken zu verlieren?
- Welche Formen der Offenlegung sind wissenschaftlich korrekt und gleichzeitig praktikabel?
- Wie kann ich im Lebenslauf zeigen, dass ich KI-Kompetenzen kritisch-reflektiert beherrsche?
Link
- APA Style Blog – How to cite ChatGPT. https://apastyle.apa.org/blog/how-to-cite-chatgpt

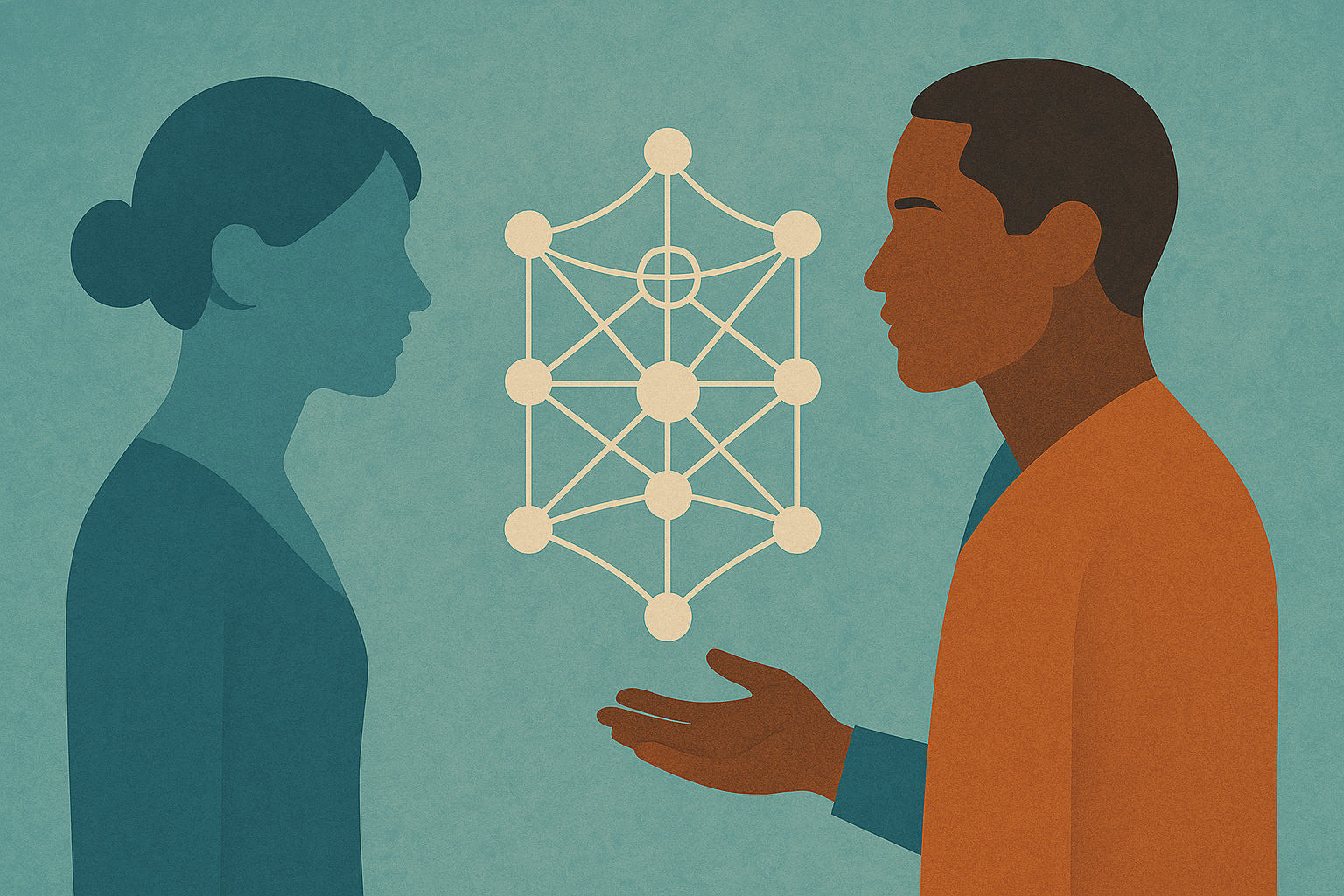
Schreibe einen Kommentar